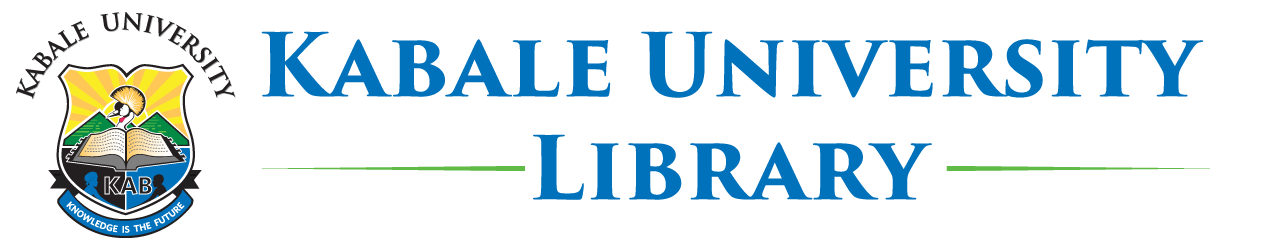Mozart, Ravel, die imperfizierte Kadenz und die perfekte Melodie. Zwei Melodien aus Mozarts Klarinettenquintett KV 581 und Ravels Klavierkonzert G-Dur
Maurice Ravel bekundete, er habe den Mittelsatz seines Klavierkonzertes G-Dur nach dem Modell des langsamen Satzes von Mozarts Klarinettenquintett A-Dur KV 581 geschaffen. Die äußere Form, die als A-B-A' denkbar allgemein gehalten ist, kann damit kaum gemeint sein. Im Detail ist Ravels Technik...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | deu |
| Published: |
Gesellschaft für Musiktheorie (GMTH)
2008-01-01
|
| Series: | Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://storage.gmth.de/zgmth/pdf/274 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Maurice Ravel bekundete, er habe den Mittelsatz seines Klavierkonzertes G-Dur nach dem Modell des langsamen Satzes von Mozarts Klarinettenquintett A-Dur KV 581 geschaffen. Die äußere Form, die als A-B-A' denkbar allgemein gehalten ist, kann damit kaum gemeint sein. Im Detail ist Ravels Technik des Formens der Mozartschen sogar ziemlich entgegengesetzt: dort klar abgegrenztes periodisches Denken, hier endlose, sich fortspinnende Melodien. Dennoch scheint ›Melodie‹ der wesentliche Berührungspunkt zwischen den beiden Komponisten zu sein: Beide Komponisten schaffen Schönheit in der Linie; Ravel greift zu ähnlichen Methoden der Höhepunktbildung, der Ambitussymmetrie und der Phrasenerweiterung wie Mozart – wir sehen analoge Imperfizierungen der Kadenz (Trugschlüssigkeit), die streng symmetrische Tonraumerweiterung um einen zentralen Ton (nicht notwendigerweise Grundton oder Ténor) und damit einhergehend eine sensible Eleganz bei der Setzung von Höhepunkten. Die vergleichende Analyse der beiden Anfangsmelodien zeigt, dass sich Ravel die Formprinzipien der Melodiebildung des Mozart-Beispieles aneignet, in seine Gegenwart transportiert und sich anverwandelt. |
|---|---|
| ISSN: | 1862-6742 |