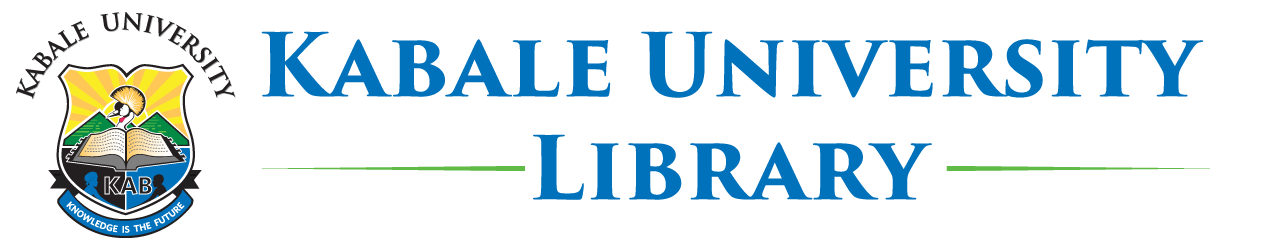Konkurrenz, sittliche Pathologien und Marktsozialismus.
Im sechsten Kapitel seiner Studie, Wirtschaft, Demokratie und liberaler Sozialismus, untersucht Hannes Kuch sittliche Pathologien der kapitalistischen Gesellschaft. Er argumentiert, dass solche Pathologien entstehen, wenn Lernerfahrungen im Markt zu Einstellungen führen, die negative Auswirkungen a...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | deu |
| Published: |
Universität Salzburg
2025-01-01
|
| Series: | Zeitschrift für Praktische Philosophie |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://127.0.0.1/zfpp/article/view/575 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1832575283252690944 |
|---|---|
| author | Timo Jütten |
| author_facet | Timo Jütten |
| author_sort | Timo Jütten |
| collection | DOAJ |
| description |
Im sechsten Kapitel seiner Studie, Wirtschaft, Demokratie und liberaler Sozialismus, untersucht Hannes Kuch sittliche Pathologien der kapitalistischen Gesellschaft. Er argumentiert, dass solche Pathologien entstehen, wenn Lernerfahrungen im Markt zu Einstellungen führen, die negative Auswirkungen auf andere soziale Sphären haben und den demokratischen Ethos untergraben. In diesem Kommentar gehe ich auf zwei Aspekte seiner These ein. Erstens untersuche ich ihre empirischen Grundlagen in der Verhaltensökonomie; zweitens die neue Analyse des Autoritarismus, den sie vorschlägt. Kuchs Diagnose der sittlichen Pathologien des Kapitalismus stützt sich zum Teil auf verhaltensökonomische Studien zu den moralischen Konsequenzen von Marktbeziehungen. Diese Studien zeigen, dass Marktbeziehungen langfristig zur Erosion moralischer Handlungsmotive führen können. Dieser Tendenz kann aber entgegengewirkt werden, wenn Marktbeziehungen in rechtsstaatliche Institutionen und eine vertrauensbildende Kultur eingebettet sind. Die verhaltensökonomischen Studien, die Kuch diskutiert, beziehen sich jedoch auf Entscheidungen, in denen Subjekte zwischen Geld und moralischem Handeln wählen müssen oder Geld verteilen müssen, und nicht um Marktbeziehungen, in denen Konkurrenz und Wettbewerb eine Rolle spielen. Ich argumentiere, dass solche Konkurrenzsituationen besonders zersetzend für moralische Beziehungen sein können, weil sie Subjekte gegeneinander ausspielen. Die Frage ist, ob es möglich ist, auch gegen diese Erosion moralischer Motive wirksame Gegenmittel zu finden. Kuchs Analyse des Autoritarismus besagt, dass Menschen im Kapitalismus lernen, dass das Recht des Stärkeren ein legitimes Handlungsprinzip ist, und dass die Normalisierung solcher Prinzipien im Umgang mit schwächeren Gruppen eine wesentliche Rolle in der Erklärung des neuen Autoritarismus spielt. Das ist plausibel. Insbesondere glaube ich, dass eine neoliberale Version des meritokratischen Gedankens dieser Entwicklung zu Grunde liegt. Subjekte sehen sich als Gewinner oder Verlierer ständiger Statuswettbewerbe, und wenn sie auf der Verliererseite stehen, kompensieren sie den drohenden Statusverlust mit der Unterdrückung schwächerer. Die Frage ist, ob eine weniger radikale Reaktion dieser Art auch im Marktsozialismus drohen könnte, weil dieser ja noch transparenter als der Kapitalismus den Subjekten zeigt, wieviel Wert ihr je eigener gesellschaftlicher Beitrag hat. Kann der Marktsozialismus einer solchen Entwicklung entgegenwirken?
|
| format | Article |
| id | doaj-art-2c91d6fab3a143deb85a074fdf26189b |
| institution | Kabale University |
| issn | 2409-9961 |
| language | deu |
| publishDate | 2025-01-01 |
| publisher | Universität Salzburg |
| record_format | Article |
| series | Zeitschrift für Praktische Philosophie |
| spelling | doaj-art-2c91d6fab3a143deb85a074fdf26189b2025-02-01T09:57:59ZdeuUniversität SalzburgZeitschrift für Praktische Philosophie2409-99612025-01-0111210.22613/zfpp/11.2.14Konkurrenz, sittliche Pathologien und Marktsozialismus.Timo Jütten Im sechsten Kapitel seiner Studie, Wirtschaft, Demokratie und liberaler Sozialismus, untersucht Hannes Kuch sittliche Pathologien der kapitalistischen Gesellschaft. Er argumentiert, dass solche Pathologien entstehen, wenn Lernerfahrungen im Markt zu Einstellungen führen, die negative Auswirkungen auf andere soziale Sphären haben und den demokratischen Ethos untergraben. In diesem Kommentar gehe ich auf zwei Aspekte seiner These ein. Erstens untersuche ich ihre empirischen Grundlagen in der Verhaltensökonomie; zweitens die neue Analyse des Autoritarismus, den sie vorschlägt. Kuchs Diagnose der sittlichen Pathologien des Kapitalismus stützt sich zum Teil auf verhaltensökonomische Studien zu den moralischen Konsequenzen von Marktbeziehungen. Diese Studien zeigen, dass Marktbeziehungen langfristig zur Erosion moralischer Handlungsmotive führen können. Dieser Tendenz kann aber entgegengewirkt werden, wenn Marktbeziehungen in rechtsstaatliche Institutionen und eine vertrauensbildende Kultur eingebettet sind. Die verhaltensökonomischen Studien, die Kuch diskutiert, beziehen sich jedoch auf Entscheidungen, in denen Subjekte zwischen Geld und moralischem Handeln wählen müssen oder Geld verteilen müssen, und nicht um Marktbeziehungen, in denen Konkurrenz und Wettbewerb eine Rolle spielen. Ich argumentiere, dass solche Konkurrenzsituationen besonders zersetzend für moralische Beziehungen sein können, weil sie Subjekte gegeneinander ausspielen. Die Frage ist, ob es möglich ist, auch gegen diese Erosion moralischer Motive wirksame Gegenmittel zu finden. Kuchs Analyse des Autoritarismus besagt, dass Menschen im Kapitalismus lernen, dass das Recht des Stärkeren ein legitimes Handlungsprinzip ist, und dass die Normalisierung solcher Prinzipien im Umgang mit schwächeren Gruppen eine wesentliche Rolle in der Erklärung des neuen Autoritarismus spielt. Das ist plausibel. Insbesondere glaube ich, dass eine neoliberale Version des meritokratischen Gedankens dieser Entwicklung zu Grunde liegt. Subjekte sehen sich als Gewinner oder Verlierer ständiger Statuswettbewerbe, und wenn sie auf der Verliererseite stehen, kompensieren sie den drohenden Statusverlust mit der Unterdrückung schwächerer. Die Frage ist, ob eine weniger radikale Reaktion dieser Art auch im Marktsozialismus drohen könnte, weil dieser ja noch transparenter als der Kapitalismus den Subjekten zeigt, wieviel Wert ihr je eigener gesellschaftlicher Beitrag hat. Kann der Marktsozialismus einer solchen Entwicklung entgegenwirken? https://127.0.0.1/zfpp/article/view/575VerhaltenökonomieWettbewerbKonkurrenzAutoritarismusStatusverlust |
| spellingShingle | Timo Jütten Konkurrenz, sittliche Pathologien und Marktsozialismus. Zeitschrift für Praktische Philosophie Verhaltenökonomie Wettbewerb Konkurrenz Autoritarismus Statusverlust |
| title | Konkurrenz, sittliche Pathologien und Marktsozialismus. |
| title_full | Konkurrenz, sittliche Pathologien und Marktsozialismus. |
| title_fullStr | Konkurrenz, sittliche Pathologien und Marktsozialismus. |
| title_full_unstemmed | Konkurrenz, sittliche Pathologien und Marktsozialismus. |
| title_short | Konkurrenz, sittliche Pathologien und Marktsozialismus. |
| title_sort | konkurrenz sittliche pathologien und marktsozialismus |
| topic | Verhaltenökonomie Wettbewerb Konkurrenz Autoritarismus Statusverlust |
| url | https://127.0.0.1/zfpp/article/view/575 |
| work_keys_str_mv | AT timojutten konkurrenzsittlichepathologienundmarktsozialismus |